Menschen imaginieren Paradiese für Menschen. Tiere kommen, wenn überhaupt, darin nur als dekorative Wohlfühlgaranten vor. Ganz selten erfindet die Literatur aber auch ein Paradies für Tiere – und zerstört diese auch gleich wieder. Was verbirgt sich hinter diesem Muster der Erfindung und Zerstörung von Paradiesen? Ich behaupte: der Versuch, tierliche Individualität begreiflich zu machen.
Am Herzen liegt mir vielmehr die Frage, ob es überhaupt denkbar ist, dass ein Tier Individualität besitzt.
In meiner Dissertation beschäftige ich mich mit literarischen Darstellungen von tierlichem Sterben. Sie mögen fragen, warum ich zum Studium dieser makabren Frage nicht einfach in die Natur gehe und mir Notizen mache, wie, wo und wann Tiere sterben? Nun, weil ich am Sterben von Tieren nicht interessiert bin, sofern es sich bei Tieren nur um Arten oder Rassen, um klassifizierbare Lebewesen also handelt. Am Herzen liegt mir vielmehr die Frage, ob es überhaupt denkbar ist, dass ein Tier Individualität besitzt. Denn eine solche würde beim Sterben den Unterschied ums Ganze machen. Sicherlich, ein Biologe kann viel besser als ich über die Ursachen des Ablebens dieser oder jener Spezies Auskunft geben. Wenn ich dagegen die Literatur statt die Natur untersuche, geht es mir um das Sterben dieser individuellen Katze oder dieser ganz speziellen Kuh, nicht einfach um Katzen oder Kühe. Ich bin überzeugt davon, dass die Literatur es besser noch als die Biologie vermag, unsere Sicht auf Tiere zu verändern.
Meine eigene Sicht geschärft und verändert hat ein umfangreicher Aufsatz des Philosophen Jacques Derrida Das Tier, das ich also bin. Darin fragt er so eindringlich wie kaum jemand zuvor, was es mit der Individualität eines Tieres auf sich hat. Vor dem Hintergrund seiner Thesen nähere ich mich zwei Tierparadiesen, um anhand ihrer literarischen Zerstörung zu zeigen, wie sie tierliche Individualität überhaupt denk- und fassbar machen.
Max Slevogt. 1897. Nini mit der Katze.
Derridas Katze
Das Tier taucht bei Derrida erst in seinen späteren Schriften auf. In Das Tier, das ich also bin (2006) hinterfragt Derrida die Wahrnehmung von Tieren in der bisherigen Philosophie. Diese spreche vom ‚Tier‘, ohne dass sie den Begriff selbst je zur Diskussion gestellt habe. Wenn Aristoteles den Menschen als animal rationale definiert, ist für ihn klar, was animal bedeutet. Es braucht nicht erklärt zu werden.
Derrida dagegen hält den Begriff Tier für eine übergeneralisierte Sammelkategorie. Zwischen den Tieren bestünden zu große Unterschiede, „die die Eidechse vom Hund, das Protozoon vom Delphin, den Hai vom Lamm, den Papagei vom Schimpansen, das Kamel vom Adler, das Eichhörnchen vom Tiger oder den Elefanten von der Katze, die Ameise vom Seidenwurm oder den gewöhnlichen Igel vom australischen Ameisenigel trennen“ (ebd.: 61). So sei es fragwürdig, Kellerasseln und Menschenaffen beide als ‚Tier‘ zu betiteln. Dazu hätten sie zu wenige Gemeinsamkeiten.
‚Schatz, könntest du heute bitte mit dem Tier rausgehen?‘
Bei der Frage nach dem Tier geht es Derrida nicht allein um eine Frage der korrekten Bezeichnung. Auf dem Spiel steht vielmehr die Frage, wie Menschen Tiere behandeln, wahrnehmen und ansprechen. Seine Katze, ein ganz besonderes Individuum, dient Derrida als Beispiel. Denn welcher Haustierbesitzer bezeichnet seinen vierbeinigen Liebling schon als dem ‚Tier‘? ‚Schatz, könntest du heute bitte mit dem Tier [!] rausgehen?‘ Abgesehen davon spricht Derrida seine Katze als Kätzin an, da er außerdem gegen die Einebnung der sexuellen Differenz opponiert. Hinter Derridas Sprachpedanterie verbirgt sich ein Idealismus, der davon träumt, tierliche Individualität zu achten – und das auf eine Weise, die weit über die Diskussion von Quadratmetern Platz pro Huhn, Rind oder Schwein hinausgeht.
Tierparadiese scheinen in der Literatur immer dort zu liegen, wo der Blick nicht auf Tiere, sondern ganz besondere Tiere fällt. Wo also Hund, Tiger und Seidenwurm sich nicht mehr den gleichen Oberbegriff teilen müssen. Wo die Pluralität der verschiedenen Lebewesen eine Bereicherung ist und wo sich ein Denken ankündigt, das Tiere in ihrer Individualität und Alterität achtet. Dazu ist die Literatur zuweilen imstande.
Max Slevogt. 1914. Sandsturm in der lybischen Wüste.
Canettis Kamele
Der Geruch von Weihrauch, Gewürzen und Holzkohle liegt in der Luft. In den Gassen herrscht Gedränge und über ihnen flattern Stoffe einer Färberei. Händler feilschen und bieten Pfefferminztee an: Marrakesch im Jahre 1954. Elias Canetti verweilt hier zu Gast bei einem Freund. Zehn Jahre später inspiriert ihn der Aufenthalt zu seinen Reiseerinnerungen Die Stimmen von Marrakesch (1967). In ihnen widmet Canetti ein ganzes Kapitel den Kamelen. Ihnen begegnet er in einer Landschaft, die wahrlich paradiesisch anmutet: „Es war Abend, der rote Glanz auf der Mauer war am Verlöschen. Ich behielt die Mauer, solange ich konnte, im Auge und freute mich an dem allmählichen Wechsel ihrer Farbe. [E]s war ein Bild des Friedens und der Dämmerung. Die Farbe der Kamele ging in der der Mauer auf“ (ebd.: 9).
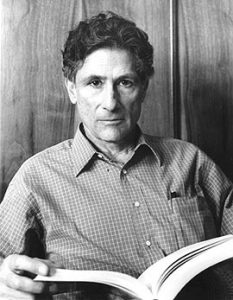
„From the beginning of Western speculation about the Orient, the one thing the orient could not do was to represent itself.“
Die Szene erinnert an die Kamelbilder, die August Macke und Paul Klee Anfang des 20. Jahrhunderts von ihrer Tunisreise mitbrachten. Licht, Form und Farbe appellieren an nordeuropäische Sehnsüchte, die Macke-Bildbetrachterinnen und Canetti-Leser bis heute überfallen können. Das Kontemplieren über die Schönheit des Maghreb geschieht derweil nicht unvoreingenommen, denn die Gäste bringen ihr Bild vom Orient schon von zu Hause aus mit: Wie einst der Literaturtheoretiker Edward Said in seinem Standardwerk Orientalism (1978) bemerkte, ist der märchenhafte Orient eher eine Fiktion denn eine Gegebenheit. Auch Canettis Kamelparadies scheint vorerst dem europäischen Blick auf exotische Tiere geschuldet. Je genauer aber Canetti hinsieht, desto paradiesischer – im Sinne Derridas – wird es für die Kamele.
„[S]ie hatten Gesichter. Sie waren sich ähnlich und doch so sehr verschieden. Sie erinnerten an alte englische Damen, die würdevoll und scheinbar gelangweilt den Tee zusammen einnehmen, aber die Bosheit, mit der sie alles um sich herum betrachten, nicht ganz verbergen können. ‚Das ist meine Tante, wirklich‘, sagte mein englischer Freund“ (Canetti 1967: 9).
Kamelen wird also ähnlich viel an individueller Bosheit zugesprochen wie Tanten. Wie im Adam-Eva-Paradies ähneln sich hier Tier und Mensch. Die Anthropomorphisierung erzeugt die Gunst und Zuneigung der Leserin für die Kamele, an deren Wohlergehen sie interessiert ist.
„Es kniete wieder. Es zuckte noch manchmal mit dem Kopf. Das Blut aus den Nüstern hatte sich weiter ausgebreitet“
(Canetti 1988: 15).
Aus dem zauberhaft-orientalischen Kamelparadieses hinauskatapultiert wird die Leserin, wenn Canetti langsam auf die Schlachtung der Tiere auf dem lokalen Kamelmarkt zusteuert. Obwohl er die Kamele dort als Tourist nur bestaunen wollte, muss er unfreiwillig mitansehen, wie sie nun auf ihren Tod warten. Der Erzähler beobachtet die „verzweifelten Bewegungen“ der Kamele, die, so berichtet ein Ortsansässiger, den Schlächter an dessen Blutgeruch erkennen. Den europäischen Touristen ergreift besonders der Anblick eines panischen Kamels, das ein Mann unter seine Gewalt bringt. Er zieht dem Kamel einen Strick durch die bereits durchbohrte Nasenwand, woraufhin das Kamel zu zucken und bluten beginnt. „Es kniete wieder. Es zuckte noch manchmal mit dem Kopf. Das Blut aus den Nüstern hatte sich weiter ausgebreitet“ (ebd.: 15). Die Brutalität ist kaum zu ertragen – nicht zuletzt, weil Canetti das Kamel weiterhin als Individuum vorführt.
Es scheint, als ob Canetti sich seines Orientalismus selbst bewusst ist. Fast einfältig imaginiert er zunächst ein Paradiesbild von Kamelen in der Abendsonne. Mit der drastischen Schilderung von Kamelindividuen und ihrer Schlachtung aber entlarvt er seine eigenen kolonial geprägten Vorstellungen. Damit verliert auch die Leserin ihren europäischen Glauben an die orientalische Exotik, gewinnt aber, beinahe tragisch fast, einen neuen Blick, eine neue Empfindung für tierliche Individualität.
Max Slevogt. 1914. Pfälzer Landschaft
„Der Knuchelklee wuchs auf gut gedüngtem Boden, und wenn er fett und saftig, mit Löwenzahnblättern vermischt und mit Tau behaftet in die Krüpfe gegabelt wurde, hielten sich die Kühe nicht zurück. Sie fraßen mit Lust, daß es spritzte und schmatzte und knackte.“ (Sterchi 1983: 77)
Sterchis Kuh
Das ist das Paradies von Blösch, einer wunderschönen Kuhdame, die im gleichnamigen Roman zusammen mit ihrer Herde den traditionellen Knuchelbauernhof bewohnt. Hier ist der Ort, an dem sie ganz Individuum sein darf, mit allem, was für eine Leitkuh der Herde dazugehört: Niemals würde sie es sich nehmen lassen, als allererste den Stall zu verlassen, um dann gleichfalls als allererste vom noch unberührten, kristallklaren Brunnenwasser zu kosten. Jede Kuh hat hier ihren eigenen Namen und erhält vom Bauern täglich ihre ganz persönliche Hege- und Pflegeeinheit. Dass man den Kühen diese individuellen Züge zugesteht, anstatt sie industriell zu tilgen, dass man sie überhaupt als Individuen wahrnimmt, scheint Voraussetzung dieses Tierparadieses zu sein – auch für die Leserin.
„Die Wunden Blöschs waren seine Wunden, der verlorene Fellglanz war sein Verlust“ (Sterchi 1983: 405).
Unterm Strich wird der Knuchelhof zum Inbegriff von heiler Heimat. Dem Blick der Leserin kann also auch das Paradies vor der eigenen Haustür zur Wirklichkeit werden. Doch wer den Roman gelesen hat, weiss, dass es mit dem Paradies nicht immer weit her ist. Vielmehr oszilliert das Geschehen auch hier zwischen dem Tierparadies Knuchelhof und einem Schlachthaus, in das Blösch eines Tages eingeliefert wird. Der Knuchelhof ist also lediglich ein Paradies auf Zeit, das in der in den 1960-er Jahren angesiedelten Romanhandlung der Industrialisierung von Landwirtschaft und Schlachtbetrieb zum Opfer fällt. Überdies gehört zum Heimatparadies von Anfang an das Menetekel der Fremdenfeindlichkeit, die Ambrosio, dem spanischen Melker, mit zunehmender Heftigkeit entgegenschlägt. Am Ende steht das Leiden Blöschs für das Leiden aller anderen Kühe, aber auch für dasjenige ihres Melkers. „Die Wunden Blöschs waren seine Wunden, der verlorene Fellglanz war sein Verlust“ (ebd.: 405)
Blöschs Wunden sind des Melkers Wunden. Das speziesübergreifende Leiden dient hier nicht nur als Parabel für Industrialisierungsfolgen, sondern auch als Individualitätslieferant. Ambrosio vermacht, auf literarischem Wege zumindest, Blösch einen Teil seiner Individualität und Verletzlichkeit.
Fazit
Nun müsste die ganze Weltliteratur auf ihre Darstellung von Tieren hin untersucht werden. Schliesslich tummeln sich in Fabeln, Parabeln und Tiergeschichten zuhauf Tiere mit individuellem Charakter und Willen. Pferde wie der Leinwandmesser (Tolstoi) oder Gringuliete (Wolfram von Eschenbach), die Maltakatze (Kipling) oder der Hund Swipp (Lindgren) – sie alle sind mehr als nur Tiere. Sie verfügen über Erinnerungsvermögen, über ein Innenleben und natürlich auch über eine ganz individuelle Geschichte. Allerdings fehlt mir in vielen Erzählungen eine Einsicht, auf der auch Derrida beharrt: Es geht nicht wie in Fabeln darum, Tiere als Menschen zu begreifen. Vielmehr geht es darum, ein Tier als ein individuelles und einzigartiges Lebewesen zu denken. Als ein Tier mit Individualität eben. Und diese macht sich zum gegenwärtigen Stand der Literatur noch im Sterben von Tieren am besten bemerkbar. Hoffentlich nicht mehr lange.
Literatur
Canetti, Elias. 1988 [1967]. „Begegnungen mit Kamelen“, In: Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise. München, Wien: 7–16.
Derrida, Jacques. 2010 [2006]. Das Tier, das ich also bin. Wien
Said, Edward W.. 2003 [1978]. Orientalism. London
Sterchi, Beat. 1983. Blösch. Zürich.
Bildnachweis
Das Titelbild wurde uns freundlicherweise von Lumas zur Verfügung gestellt.
Bildtitel: L’Embarquement pour Cythère Nº 12
Jahr: 2013/15
Künstlerin: Isabelle Menin
Erhältlich bei: www.lumas.com
uncode-placeholder
Julia Stetter
Julia Stetter hat Germanistik und Erziehungswissenschaften studiert. Derzeit schreibt sie an der Uni Bochum eine Dissertation über tierliches Sterben.









Mir gefällt die Grundidee des Projekts wahnsinnig gut: die Fragilität tierischer Paradies und der Zusammenhang von Individualität und Sterben! Als Philosoph neigt man aber zur Krittelei. Ich will dieser Neigung hier etwas folgen. Der Artikel vertritt die Auffassung, dass die Literatur besser darin ist als die Biologie unsere Sicht auf Tiere zu verändern. Es geht um die Frage des tierlichen Sterbens. Warum nicht einfach in die Natur gehen und notieren, wie, wo und wann Tiere sterben? Die Antwort im Artikel lautet, dass man bei dieser Tätigkeit nicht individuelle Tiere, sondern nur Tiere als Arten oder Rassen, als klassifizierbare Lebewesen in den Blick bekommt. Dieses Argument finde ich nicht recht überzeugend. Eine Naturbeobachterin ist durchaus in der Lage Tiere als Individuen zu beobachten, sie muss die Tiere nicht nur als Arten oder Rassen sehen. Wenn sie gut ist, kann sie die Tiere sogar individuell auseinanderhalten und genau kennen. Dian Fossys Beschreibung des Todes des Gorillass Digit (sein Name stammt von zwei verwachsenen Fingern, eines der Individualitätszeichen dieses Tiers) ist ein bewegendes Zeugnis dafür. Allerdings stimmt es, dass die Biologie einige Mühe hat die Individualität von Tieren wissenschaftliche zu erfassen. Neuerdings versucht man es mit standardisierten Persönlichkeitsmerkmalen. Das hindert biologische Naturbeobachter jedoch nicht, Tiere als Individuen wahrzunehmen, im Gegenteil, es ist für viele Freilandbeobachtungen (Datensammlungen, Experimente) ausschlaggebend, dass man lernt Individuen an Aussehen und Stimme zu unterscheiden. Aber sogar wenn man zugibt, dass die Biologie Mühe hat, tierliche Individualität zu konzeptualisieren, so stützt diese Überlegung alleine ja noch nicht die viel weitergehende These, dass Literatur besser darin ist als Biologie unsere Sicht auf Tiere zu verändern. Intuitiv würde ich (bei aller Liebe zur Literatur) zum Gegenteil neigen. Die Erkenntnisse über Menschenaffen, Delfine, Krähen, Hunde, Fische, Otter oder Biber haben unsere Sicht auf Tiere in den letzten 60 Jahren weitaus stärker verändert als die Literatur. Die literarische Produktion neigt trotz einiger Ausnahmen im Grossen und Ganzen eher zu einer Zementierung unseres kulturellen Blicks auf die Tiere. Die Literatur ist hier konservativ. Allerdings könnte man sagen, dass bestimmte Biologinnen und Biologen besondere literarische Mittel eingesetzt haben, um unseren Blick auf die Tiere zu ändern. Dian Fossey wäre nur ein Beispiel dafür.
Vielen Dank für Ihre umfangreichen Kommentare. Ich habe mich total darüber gefreut, zumal ich auch schon in meiner Masterarbeit auf Ihre Erklärungen zur anthropologischen Differenz gewinnbringend zurückgreifen konnte, die ich damals Ihrer „Tierphilosophie zur Einführung“ entnommen habe, um damit unter anderem Hermann Hesses Erzählung „Der Wolf“ zu analysieren.
Worum es bei der Kontroverse Biologie versus Literatur m.E. im Grunde geht ist der alte Streit zwischen einem Anti-Kognitivismus und einem starken Kognitivismus: Der Anti-Kognitivismus würde eine scharfe Grenze zwischen wissenschaftlichem Tierwissen und fiktionaler Tierthematisierung ziehen und damit Literatur tendenziell Erkenntnispotenzial absprechen. Der starke Kognitivismus hingegen argumentiert ja gegen einen solchen Ausschließlichkeitsanspruch des wissenschaftlichen Wissens, um im Sinne Baumgartens/Adornos den Nutzen der ästhetischen Erfahrung in Abgrenzung zu einem rein logisch-begrifflichen Wissen zu pointieren. In letztere kognitivistische Richtung hatte ich gedacht. Aber ich stimme Ihnen voll zu, dass ich dabei im Artikel über das Ziel hinausgeschossen bin. Es kann keineswegs darum gehen, dass Literatur die Welt „besser“ als ein anderer Zugang erklären kann. Vielmehr würde ich für eine Pluralität und Koexistenz der Erkenntnisformen plädieren. Stärker auf der Inhalteben gedacht meine ich aber schon, dass literarische Texte wie diejenigen von Canetti, Sterchi oder Jahnn dazu geeignet sind, unseren Blick auf Tiere zu ändern. Zugegebenermaßen gibt es aber auch viele Gegenbeispiele, in denen Literatur das Gegenteil tut. Daher interessiert mich in meiner Arbeit gerade die Zeitspanne in der zweiten Hälfte des 20. Jhdts, in der sich meiner Meinung nach eine allmähliche Wandlung literarischer Darstellungen tierlichen Sterbens vollzieht.
Ja, ich denke, dass Literatur unsere Sicht auf Tiere durchaus verändern kann, auf ihr eigene Weise, und dass sie eine Erkenntnisform eigener Art sein kann. Für mich waren und sind z.B. die Gedichte von Ted Hughes ein solch neuer Blick. Im Unterschied zu genuin ethischen Ansätzen in der Tierethik fehlt Derridas Überlegungen die normative Kraft (das hat der Philosoph Gary Steiner herausgearbeitet), aber seine Arbeiten zum Tier haben … wie soll ich sagen … begriffskreative Kraft und sind deshalb anregend. Vielleicht (ein letzter Gedanke) sollte man den ästhetischen und den ethischen Aspekt einer solchen Arbeit über Tiere in der Literatur nicht zu stark trennen. Ethikrinnen wie Cora Diamond, Alice Carry, Josefine Donovan oder Lori Gruen haben darauf hingewiesen, dass es Kinder Tierethik mit generellen Prinzipien alleine nicht getan ist, sondern dass wir einen Blick auf Tiere als lebendige Individuen brauchen. Alles Gute für die Arbeit an diesem vielversprechenden Thema!
In der Regel kann man sagen: Je weiter entfernt die Autoren zeitlich sind, von denen Derrida spricht, desto ungenauer stellt er sie dar. Aristoteles war klar, was es bedeutet ein „animal“ (Lebewesen) zu sein, es bedeutet nämlich, eine Seele (psyche) zu haben. Allerdings hat Aristoteles einige Mühe darauf verwendet zu erklären, was es bedeutet, ein Lebewesen zu sein. Er hat dies u.a. in seiner Schrift „De anima“ gemacht. Der Titel wird in der Regel mit „Von der Seele“ übersetzt, könnt aber ebenso gut „Über Lebewesen“ heissen. Aristtoteles bestimmt darin die Seele als die Lebenskraft. Er unterscheidet dann drei Arten von Lebewesen: Pflanten, Tiere und Menschen. Vereinfacht gesagt können Pflanzen stoffwechseln, wachsen und sich vermehren. Das können auch Tiere. Bei Ihnen kommen aber die Fähigkeit zur Fortbewegung im Raum, die Sinneswahrnehmung und das Gedächtnis hinzu. Das können auch Menschen. Bei Ihnen kommen die Vernunft und die Sprache hinzu. Meines Erachtens kann man also gerade Aristoteles nicht vorwerfen, nicht erklärt zu haben, was der Ausdruck „Tier“ bedeute. Mehr noch, Aristoteles Bestimmung des Tiers durch die drei genannten Fähigkeiten, macht auch deutlich, warum es sinnvoll sein kann und nicht falsch sein muss, sowohl Kellerasseln als auch Menschenaffen als ‚Tier‘ zu betiteln. Trotz aller Unterschiede haben sie ausreichend Gemeinsamkeiten, die sie z.B. von Pflanzen oder Pilzen unterscheiden. Ich bezweifle jedoch sehr, dass es ausreichend Gründe gibt, den Menschen von allen anderen Tieren auf vergleichbare Weise (und mit Verweis auf Vernunft und Sprache) abzusetzen. Dieses Problem ist bereits den Philosophen und Forschern unmittelbar nach Aristoteles aufgefallen wie Richards Sorabjis grossartiges Buch „Animal Minds & Human Morals: The Origins of the Western Debate“ (1993), das für meine Arbeit über Tiere und Philosophie sehr wichtig war, zeigt. Sorabji zeigt, dass Aristoteles Tiere und Menschen einander zu sehr angenähert hat, was das Denken nach ihm in eine Krise versetzt habe.
Aristoteles vertritt ja ein Stufenschema, wie auch die philosophischen Anthropologen des 20. Jhdts, die sich an ihn anlehnen – Scheler/Plessner. Problematisch daran halte ich, dass der Mensch darin vom Tier her bzw. in Abgrenzung zum Tier bestimmt wird, was m.E. zu einer Art Zirkelschluss führt. Derrida hatte ich hier so verstanden, dass er mit seiner Dekonstruktion des Tier-Begriffs gerade diese auf der anthropologischen Differenz fußende Bestimmung des Menschen unterlaufen will. Dennoch würde ich sagen – auch wie ich es Ihrer „Tierethik zur Einführung“ entnehme – dass für eine philosophische Diskussion von Tierethik Singers Utilitarismusansatz und Regans Theorie der Tierrechte sowie Modifikationen dieser Theorien einfach zukunftsweisender als Derridas Ansatz sind. Derridas Tiertheorie schätze ich dagegen mehr für die Literatur- und Kulturtheorien als geeignet/produktiv ein.
Canettis Kamele sind ein grossartigr Text. Ich würde die Passagen aber etwas anders lesen. Hier meine Vorschläge dazu. – „’Das ist meine Tante, wirklich‘, sagte mein englischer Freund.“ Wirklich? Canettis Kamele beim Tee, die an bösartig englische Tanten erinnern, lassen nicht viel an tierlicher Individualität erkennen. Vielmehr handelt es sich um eine Typisierung. Gewisse Tiere werden mit gewissen Menschentypen in Verbindung gebracht, das Schaf mit dem Dummen, die Füchsin mit der Gerissenen, der Bär mit dem Gemütlich-Lebenshungrigen usw. Dabei sind Schaf, Füchsin oder Bär nicht als Individuen angesprochen, sondern als Spezies oder Geschlechter, die einer starken Anthropomorphisierung unterzogen werden. (Einen deutlichen Ausdruck hat diese typisierende Betrachtungsweise in Charles Le Bruns Skizzen zur Physiognomie gefunden.) Hier geht es also darum, wie Derrida sagt, Tiere als Menschen (und Menschen als Tiere) zu begreifen. Canettis Schilderung der Kamelschlachtung ist wirklich berührend. Doch geht es wirklich um Individualität? Zunächst ist es trivial, dass ein individuelles Kamel geschlachtet werden muss, man kann keine Kameltypen oder Kamelarten schlachten, sondern nur Einzelkamele. Die Schlachtung ist für alle Kamele gleichermassen grausam. Sollt es stimmen, dass sie den Schlächter am Blutgeruch erkennen, so sind alle Kamele in Angst und Schrecken. Die Individualität zeigt sich also nicht darin, dass die einzelnen Kamele geschlachtet werden. Die Individualität zeigt sich darin, dass ein Kamel besonders panisch ist. Man könnte auch sagen, dass dieses Kamel besonderen Widerstand an den Tag legt. Das zeichnet in diesem Moment seine Individualität aus. Deshalb wird es mit besonderer Härte und Grausamkeit zur Schlachtbank geführt. An dieser Stelle, so scheint mir, wird tatsächlich die Verbindung zwischen Individualität und Tod hergestellt. Das Traurige an der Sache ist, dass eine solche Individualität in den Augen Canettis und seiner Begleiterin zuvor gerade nicht existieren konnte. Zuvor sind die Kamele einfach tantig, Typen und Stereotypen, erst in der Todesangst zeigt ein Kamel seine Individualität. Allerdings scheint mir das vor dem Hintergrund von Derridas Kritik an der anthropologischen Differenz wiederum problematisch. Derrida hat Heidegger zu Recht für seine Ideologie des Seins-zum-Tode kritisiert. Laut Heidegger stirbt nur der Mensch, das Tier kann lediglich verenden. Das setzt die grosse Kluft zwischen Mensch und Tier. Heidegger zufolge stirbt jeder Mensch seinen eigenen Tod, der Tod ist des Menschen äusserste Möglichkeit, hier kann er nicht vertreten werden, hier lebt jeder Mensch in seiner Jemeinigkeit. Genau das meint in Heideggers Slang Individualität. Individualität kommt mit dem jemeinigen Sein zum Tod. – Kurz und unverblümt gesagt halte ich Heideggers These für faschistoiden Kitsch. (Ich habe insbesondere Derridas Gründe dafür in meiner „Tierphilosophie“ S. 206–212 dargelegt.) Es sollte deshalb bedenklich stimmen, dass die Individualisierung durch (brutalen und gewaltsamen) Tod auch bei Canetti auftaucht.
Ja, den Kameltext werde ich mir noch einmal genauer vornehmen. Zu berücksichtigen ist diesbzgl. auch Canettis Selbstinszenierung als Schriftsteller gegen den Tod. Insgesamt denke ich, dass der Text darauf abzielt, die Schlachtung der Kamele möglichst schockierend darzustellen. Die Anthropomorphisierung der Kamele wäre demnach diesem Zweck untergeordnet und von einer Fabel-Anthropomorphisierung im Punkt der Zielsetzung zu unterscheiden, insofern letztere Tiere ja nur als Masken benutzt. Ihrer Beurteilung von Heideggers These als faschistoidem Kitsch kann ich indes nur beipflichten.
So richtig schlau bin ich aus diesem Text nicht geworden. Einerseits wird die als Aufhänger fungierende Idee von Tierparadiesen gar nicht substantiiert. Andererseits ist mir nicht wirklich klar geworden, was die Autorin denn unter der „Individualität“ von Tieren versteht und vor welchem weiteren Horizont dies für sie von Bedeutung ist? Geht es ihr um das ethische Anliegen, dass Tiere (zumindest solche mit höheren Gehirnfunktionen(?)) über Formen von Bewusstsein und Subjektivität verfügen, woraus sich ein Rechts- und Wahrnehmungstatus ergeben sollte, der sie über Sachen hinaus hebt? Dann könnte die Literatur – worauf Markus Wild völlig zurecht hinweist – darüber wohl kaum Auskunft geben, sondern es wäre an Tieren selbst zu forschen. Oder geht es ihr diskursanalytisch darum zu beobachten, wie tierische Individualität aus menschlicher Sicht literarisch / philosophisch / wissenschaftlich konstruiert bzw. aufgrund kommunikativer / psychologischer Prozesse konstituiert wird? Das wäre aus meiner Sicht eine Frage, ohne die sich die ethische Dimension des Problems gar nicht bearbeiten lässt. Immerhin stellt sich ja die Frage, unter welchen Umständen wir uns einmal dazu verleitet sehen, Tiere als mehr oder weniger vernünftige Quasi-Subjekte zu behandeln, mit denen wir empathisch in Kommunikation treten (können / wollen) und ein andermal als bloße Objekte, die man zertreten (Ungeziefer) oder essen (Schlachttiere) kann.
Ja, letzteres. Es geht darum, wie Sprache und insbesondere Literatur unsere Wahrnehmung von Tieren prägt. Bsp.: Das englische Wort „beef“. Es bezeichnet nur das Nahrungsmittel und nicht mehr das lebende Tier, welches ja als „cow“ betitelt wird. Niemand würde ins Restaurant gehen und nach „cow“ verlangen. Sprache bewirkt hier eine Verdeckung der Tiertötung. Andererseits kann Sprache aber auch Partei für Tiere ergreifen.
Wie völlig zu Recht eingewandt wurde kann die Biologie erforschen, welche Formen von Bewusstsein Tiere haben und welchen Rechtsanspruch man daraus eventuell unter Zuhilfenahme der Philosophie ableiten könnte. In meiner Literaturanalyse wird aber eine andere Fragestellung verhandelt, insofern darin gar nicht geklärt werden soll, was man mit Tieren tun darf oder nicht. Es geht mehr darum, dass der Mensch sich selbst dabei wahrnimmt, wie er Tiere wahrnimmt – und das über Sprache. Tierliche Individualität ist diesbzgl. insofern von Belang, als dass man einem als individuell konzipierten Lebewesen natürlich ganz anders begegnet – siehe Haustiere. Von Nutzen sein kann dieser literaturwissenschaftliche Ansatz vielleicht insofern, als dass er beschreibt, wie über ästhetische Erfahrung bei Lesern Haltungsänderungen erfolgen. Die ethische Dimension, die Literatur dabei unterstellt wird, geht dann in die Richtung einer Selbstreflexion ihrer Leser über Kunsterleben.
Mir ist diese Diskussion – ehrlich gesagt – zu akademisch und zu wenig realitätsbezogen. Im deutschen „Bürgerlichen Gesetzbuch“ (BGB) hat das Tier eine ganz merkwürdige Rechtsstellung, wenn dort steht: „Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.“ (§90a)
Wenn ein Tier z.B. bei einem Unfall verletzt wird, spricht das Gesetz von Sachbeschädigung. Bei Tierquälerei wiederum kommt neben dem Tierschutzgesetz auch das Strafrecht zur Anwendung, weil es ja zwei Geschädigte gibt: das Tier und dessen Besitzer. Wird einerseits das Tier durch das Tierschutzgesetz geschützt, so andererseits auch der Eigentümer, dessen Eigentum ja „beschädigt“ wurde, was also einem Straftatbestand entspricht. Demnach kann der Täter für beide Delikte belangt werden. Soweit das Gesetz! Auch wenn ein Eigentümer laut Gesetz mit seinem Hund im Gegensatz zu anderen „Sachen“, die ihm gehören, nicht machen kann, was er will, zeigt doch die Massentierhaltung gerade ein völlig anderes Bild. Wir sehen alltäglich diese Bilder und sind darüber entsetzt, aber keinem Politiker käme es in den Sinn, nach der „Individualität“ des Tieres zu fragen, wenn Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Was also heißt Tierschutz wirklich, auch wenn er seit 2002 in Deutschland in die Verfassung aufgenommen wurde? In Wahrheit doch nicht viel, oder?
Nun – es gibt Entwicklungen. In Sinclairs Roman „Dschungel“, der die Bedingungen der Chicagoer Schlachthäuser zu Beginn des 20. Jhds realitätsgetreu abbildet, wurden Schweine noch systematisch bei vollem Bewusstsein kopfüber aufgehängt und anschließend ohne Betäubung getötet. Das ist in Deutschland mittlerweile verboten. (Auch wenn in der Realität aufgrund von Akkordarbeit etc. immer noch die Betäubung mancher Tiere leider schlicht vergessen wird.) Zudem wurde die Käfighaltung für Hühner 2010 in Deutschland verboten. Der Ersatz für sie, die sogenannte Kleingruppenhaltung – de facto nur eine neue Legebatterie unter anderem Namen – soll nun endgültig 2025 bzw. mit Ausnahmen 2028 verboten werden. Sicher zeigt dies, dass es noch ein weiter Weg ist. Aber man sollte hier nicht pauschalisieren, dass alle Bemühungen von Tierschützern wertlos gewesen wären.
Aber solange die Lobbyisten der Fleischindustrie weiterhin ihren massiven Einfluss in der Politik geltend machen und solange immer mehr Fleisch aufgrund der niedrigen Preise verzehrt wird, mache ich mir da wenig Hoffnungen. Zudem verschwinden immer mehr Tierarten von der Landkarte und auch die Lebensbedingungen der Tiere in den Zoos sind teilweise besorgniserregend, davon kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Letztes Endes wird alles darauf hinauslaufen: Ich liebe MEINEN Hund und kann ihm deshalb ein „menschenwürdiges“ Leben und Sterben ermöglichen.
Die Bedenken von Wilfried Heise über unsere brutale Vergegenständlichung von Tieren, die Zweifel daran, ob Tierschutzbestimmungen wirklich im Sinne der Tiere sind und nicht primär gesetzlich abgestützte Marketingstrategien für Kundenzufriedenheit, sowie den Hinweis auf die Schizophrenie in unserer sehr ungleichen Behandlung von (beispielsweise) Hunden und Schweinen kann ich voll und ganz unterschreiben. Ein entscheidender Punkt für das triste Los der Tiere ist, dass sie Eigentum sein können und keine Grundrechte haben. Ich sehe jedoch nicht, dass dies dagegen spricht ein vielversprechendes Promotionsprojekt über Tierparadiese und Tierindividualität zu unternehmen. Erstens ist das ein wissenschaftlich interessantes Thema und der Einbezug von Tieren in den Kultur- und Sozialwissenschaften ist eine nicht unwichtige Errungenschaft der letzten Jahre (man überlasst sie nicht nur der Zoologie und Biomedizin). Zweitens kann das genaue Hinschauen auf Tiere in unterschiedlichen Bereichen einen positiven Effekt auf das Bewusstsein dafür haben, womit wir es eigentlich zu tun haben. Drittens schliesslich ist der Hinweis auf tierliche Individualität immer wieder ein probates Mittel, um Konsumenten und Konsumentinnen vor Augen zu führen, wesen Teile und Produkte sie einkaufen.
Das Tier ist das andere, das notwendig andere, ohne dass es den Menschen nicht geben kann. Wie die Vernunft des Wahnsinns bedarf, so bedarf der Mensch des Tieres. Und das bedeutet: Er benötigt die Kategorie des Tieres, nicht das einzelne Tier. Es ist nebensächlich, dass die Kategorien der Tiere so brüchig sind wie die Kategorien der Rasse und des Geschlechts. Ihre Effekte alleine zählen. Adorno und Horkheimer haben alles Relevante dazu gesagt: «Die Idee des Menschen in der europäischen Geschichte drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus. Mit seiner Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde. Mit solcher Beharrlichkeit und Einstimmigkeit ist der Gegensatz von allen Vorvorderen des bürgerlichen Denkens, den alten Juden, Stoikern und Kirchenvätern, dann durchs Mittelalter und die Neuzeit hergebetet worden, daß er wie wenige Ideen zum Grundbestand der westlichen Anthropologie gehört».
Allerdings leben wir einem System, das die Entindividualisierung nötig hat. Melanie Joy hat das unter dem Begriff des «Karnismus» gefasst. Freilich, ihre Analyse bleibt zu individualistisch und zu psychologisch. Dennoch ist es wichtig zu begreifen, dass durch Ideologie Tiere entindividualisiert werden. Aber diese Entindividualisierung ist ein Effekt: Nicht, weil Tiere weniger wert sind, essen wir sie, sondern weil wir sie essen, sind sie weniger wert.